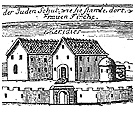 |
Interdisziplinäres Forum »Jüdische Geschichte und Kultur in der Frühen Neuzeit und im Übergang zur Moderne« | ||
|
|||
|
Tagung 2003 |
Ego-Dokumente, Selbst- und Fremddarstellungen frühneuzeitlicher Juden: Einführung in das TagungsthemaBirgit KLEIN, Düsseldorf Das Rahmenthema erwies sich als aktuell, widmet sich doch das zweite Heft der Internet-Zeitschrift »Zeitenblicke« (Jg. 1, 2002, www.zeitenblicke.historicum.net/2002/02/index.html) dem Thema »Das ›Ich‹ in der Frühen Neuzeit. Autobiographien – Selbstzeugnisse – Ego-Dokumente in geschichts- und literaturwissenschaftlicher Perspektive«. Hierin gibt der Beitrag von Andreas Rutz »Ego-Dokument oder Ich-Konstruktion? Selbstzeugnisse zur Erforschung des frühneuzeitlichen Menschen« einen instruktiven Überblick über die Forschungsgeschichte.. Der Begriff »Egodocumente[n]« wurde bereits in den 1950er Jahren von dem niederländischen Historiker Jacques Presser geprägt und von Rudolf Dekker für die Geschichtswissenschaft fruchtbar gemacht. Presser und in der Folge Dekker bezogen sich in ihren Begriffsbestimmungen vor allem auf Tagebücher, Memoiren, Reiseberichte und Briefe, Quellen also, denen gemeinsam ist, dass der Autor, formal in der »Ich-Form«, darin etwas über sich selbst mitteilt, «über sein eigenes Handeln und Fühlen und über Dinge und Vorgänge, die ihn persönlich betreffen» (Übersetzung aus dem Niederländischen BK). Es geht um die freiwillige und bewusste Mitteilung, vergleichbar dem deutschen Begriff »Selbstzeugnis«. Wegweisend für die deutsche Forschung erwies sich 1992 die Arbeitstagung »Ego-Dokumente«, anlässlich derer Winfried Schulze dem Begriff »Ego-Dokumente« im Deutschen eine sehr viel umfassendere Definition gab: »Gemeinsames Kriterium aller Texte, die als Ego-Dokumente bezeichnet werden können, sollte es sein, daß Aussagen oder Aussagenpartikel vorliegen, die – wenn auch in rudimentärer und verdeckter Form – über die freiwillige oder erzwungene Selbstwahrnehmung eines Menschen in seiner Familie, seiner Gemeinde, seinem Land oder seiner sozialen Schicht Auskunft geben oder sein Verhältnis zu diesen Systemen und deren Veränderungen reflektieren. Sie sollten individuell-menschliches Verhalten rechtfertigen, Ängste offenbaren, Wissensbestände darlegen, Wertvorstellungen beleuchten, Lebenserfahrungen und -erwartungen widerspiegeln.« Schulze unterscheidet nicht mehr zwischen selbst verfassten Texten und Verwaltungsschriftgut, sondern nimmt die Kategorien der »freiwilligen« und »unfreiwilligen« Aussagen zur Person zusammen. Folglich lassen sich unter dieser erweiterten Definition noch eine sehr viel größere Anzahl von Quellengattungen neben den bereits genannten heranziehen: Bittschriften und Testamente ebenso wie Strafprozessakten, Steuererhebungen, Visitationen, Einstellungsbefragungen oder auch Kaufmanns-, Rechnungs- und Anschreibebücher, die personengebundene Informationen enthalten. Unter den Beiträgen der Arbeitstagung (erschienen Berlin 1996 unter dem Titel Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte, hrsg. von Winfried Schulze, ebd. S. 28 das Zitat zum Begriff »Ego-Dokumente«) befinden sich die von Claudia Ulbrich »Zeuginnen und Bittstellerinnen. Überlegungen zur Bedeutung von Ego-Dokumenten für die Erforschung weiblicher Selbstwahrnehmung in der ländlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts« und Helga Schnabel-Schüle »Ego-Dokumente im frühneuzeitlichen Strafprozess«. Zahlreiche, in den letzten Jahren erschienene Aufsatzbände habe die Diskussion fortgeführt, zuletzt Gabriele Janckes Monographie:Autobiographie als soziale Praxis. Beziehungskonzepte in Selbstzeugnissen des 15. und 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum" (Köln / Weimar / Wien 2002). Die Mülheimer Tagung stellte sich der Aufgabe zu untersuchen, inwiefern die Methoden, welche die Frühneuzeitforschung entwickelt hat, für die Erforschung der jüdischen Geschichte und Kultur fruchtbar gemacht werden können und wo der Übertragbarkeit Grenzen gesetzt sind. So galt es etwa danach zu fragen, wie sich Jüdinnen in Prozessakten definieren: über ihr Jüdischsein oder über ihr Geschlecht? Welche Verstellungen oder Maskierungen der eigenen Person sowie des eigenen Denkens und Empfindens gehören zur typologischen Rhetorik von Juden und Jüdinnen in Suppliken? Inwieweit griff man zum Mittel einer variablen Selbstdarstellung, um in Verhören auf den Erwartungshorizont des Gegenübers einzugehen? Inwiefern geben solche Zeugnisse weniger Auskunft über die Person selbst als vielmehr über ihr Verhältnis zur Umwelt? Doch so viele Fragen und methodische Probleme sich auf der Tagung bei der Interpretation und Deutung der frühneuzeitlichen Selbstzeugnisse und Ego-Dokumente stellten, so wenig sollte zu bezweifeln sein, dass gerade auch die jeweiligen Ich-Konstruktionen die historisch-bedingte Mentalität ihrer jüdischen Verfasser spiegeln, wie die nun folgenden Beiträge zeigen. Birgit Klein |